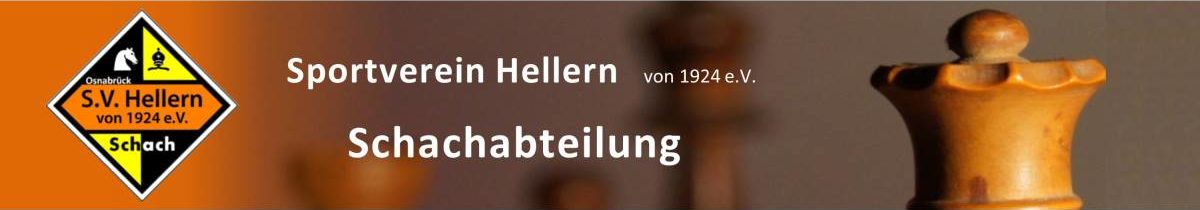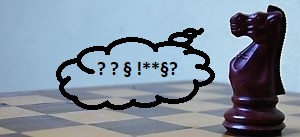Schach-Euphorie, das Buch des holländische Sportjournalisten Peter Doggers, hat eine klare Aussage: Die Digitalisierung des Schachs ist die größte Revolution, die das Schachspiel bislang erlebte. Online-Schach, multi-mediales Streaming und unschlagbare Engines geben mittlerweile den Takt im Schach vor. Viele Millionen Menschen spielen weltweit und pro Tag online auf Plattformen wie chess.com oder nutzen professionelle Trainings-Angebote. Warum dies so erfolgreich ist, erfährt man in dem sehr empfehlenswerten Buch.
„Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“
Die Fische, das sind wir. Also alle, die mittlerweile lieber online die Figuren über’s Brett gleiten lassen als im heimischen Schachverein vor einem Holzbrett zu sitzen. Und die Angler sind die Global Player der digitalen Schachszene, die in rasantem Tempo alles versuchen, um einen Spitzenplatz im Haifischbecken des digitalen Schachs zu ergattern. Die Konkurrenz schläft nicht, denn mit Schach lässt sich mittlerweile viel Geld verdienen.
Wie sich die Revolution des digitalen Schachs in den letzten Jahren geradezu explosiv entwickelt hat, untersucht Peter Doggers in einem 480 Seiten starken Buch. „Schach-Euphorie“ (Untertitel „Warum das königliche Spiel uns immer wieder neu begeistert“) ist ein herausragendes Buch, das enorm viel zu bieten hat – und das zu einem Schnäppchenpreis von € 14,99.
Denn digitale Revolution kam schneller als man es erwartet hatte. Peter Doggers erklärt, warum dies so war und immer noch ist. Mein Rat an den Leser: Überspringen Sie Teil I, denn man muss über ein Viertel des Buches lesen, ohne der digitalen Revolution im Schach einen Schritt nähergekommen zu sein! Doggers differenzierte und oft kleinteilige Informationstiefe zeigt, dass der Autor über alles berichten wollte, was mit Schach zu tun hat und nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Teil I kann man daher zum Schluss lesen. Es geht um Themen wie Schachgeschichte, Schach und Medien, Schach und Wissenschaft, Schach und Psychologie oder Frauen und Schach. Alles von Peter Doggers flott und stilsicher geschrieben. Einige Kapitel sind brillant, andere lassen den Leser leider ratlos zurück, etwa wenn Analogien zwischen Schach und Sprachtheorie sowie Semiotik auf einer Seite abgehandelt werden.
Die folgende Rezension beschäftigt sich mit Teil II und III. Besprochen wird nicht das analoge Buch, sondern die digitale Kindle-Ausgabe. Gleich vorweg: Peter Doggers (1975) ist Direktor für Nachrichten und Veranstaltungen bei Chess.com, dem Marktführer im Online-Schach. Und so überrascht es nicht, dass der Holländer seinen Brötchengeber gerne in den Fokus stellt. Nicht zu Unrecht, denn chess.com hatte im Frühjahr 2024 167 Millionen registrierte Nutzer – ein einsamer Rekord.
Vernetztes Schachspielen war Magie
Ob analoge Schachvereine dem Glamour der digitalen Plattformen gewachsen sind? Das ist die Frage, die sich der Rezensent gestellt hat. Doggers Antwort ist deutlich: „Der Schachklub alten Stils ist definitiv unter Druck geraten. Gäbe es das Internet nicht, wären die Klubs heute sicher größer. Es spielen wirklich viele Menschen im Internet und die Klubkultur interessiert sie nicht sehr“, erklärte Doggers vor einigen Monaten in einem Interview mit dem Deutschen Schachbund. „(Die) Internetkonkurrenz ist mächtig und es braucht gute Konzepte für die Klubs, dann werden sie weiter bestehen.“ Das könnte eine Dystopie sein, aber Doggers ist kein bissiger Pessimist, sondern bleibt sachlich und neutral. Und begeisterungsfähig!
Meine erste Begegnung mit dem digitalen Schach hatte mich nicht nur begeistert – sie war ein magisches Erlebnis! Mitte der 1980er Jahre lud mich mein 2012 leider zu früh verstorbener Schachfreund Frank Schumacher dazu ein, ihn in der Uni Münster zu besuchen. Im Rechnerkeller – heute würde man IT-Leitzentrale sagen – fragte er mich, ob ich Lust hätte, mit einem Chinesen Schach zu spielen.
Ich drehte mich um – im Raum war kein Chinese! Stattdessen stellte Frank – Großrechner in Universitäten waren schon seit 1969 vernetzt – die Verbindung zu einer anderen Uni her. Auf dem Bildschirm erschien ein schlichtes Schachbrett. Wenige Minuten später spielte ich Schach mit einem Unsichtbaren. In einer Zeit, in der es Begriffe wie „Internet“ oder „World Wide Web“ noch nicht gab. Dass diese Erfahrung viele Jahre lang ein Privileg bleiben würde, war für mich klar. Ich irrte mich.
Mensch gegen Maschine
Die Jüngeren unter uns wurden in einer Zeit geboren, in der die Digitalisierung in allen Bereichen des täglichen Lebens selbstverständlich geworden ist. Stockfish, die stärkste Engine der Welt, kann man, ohne einen Cent zahlen zu müssen, im Internet downloaden. Datenbanken mit Millionen Partien sind normal.
Vor 60 Jahren war dies nicht einmal für die kühnsten Pioniere des Computerschachs denkbar. Doggers kehrt daher zu Recht zu den Anfängen zurück. Zu Charles Babbage, einem Erfinder, der bereits 1822 einen mechanischen Computer mit logarithmischen Tabellen bauen wollte. Zu Alan Turing, der 1948 das Schachprogramm „Turochamp“ entwickelte, aber den Algorithmus mit Bleistift und Papier berechnen musste. Turing war übrigens der erste Wissenschaftler, der sich mit KI und Schach beschäftigte.
Als der Mathematiker Claude Shannon berechnete, dass die Anzahl der möglichen Stellungen größer ist als die Anzahl der Atome im Universum, war klar, dass man eine völlig neue Technologie brauchen würde, um mit einem Rechner Schach spielen zu können. Auch der 1957 von IBM entwickelte Großrechner schaffte es nicht – er brauchte acht Minuten für einen Zug. Und der war nicht immer gut.
Der nächste Quantensprung folgte laut Doggers bereits nach 10 Jahren. 1966/67 wurde eine Computerpartie zwischen den USA und der UdSSR per Telegrafie ausgetragen, die der sowjetische Computer mit einem Programm gewann, das 1974 unter dem Namen Kaissa der erste Gewinner einer Computerschach-WM wurde. Für den gewöhnlichen Schachspieler blieben die Programme zunächst unerreichbar. Die wichtigere Frage war: Kann ein Computer den Menschen auf den 64 Feldern besiegen?
Es sollte sogar 23 Jahre dauern. Dann gewann 1989 Deep Thought alle vier Partien in einem Match gegen den britische IM David Levy. Im gleichen Jahr besiegte Schachweltmeister Gary Kasparov Deep Thought in zwei Partien. Danach wurde die Latte höher gelegt: Kann ein Computer den Schachweltmeister in die Knie zwingen? Kasparov wollte davon nichts wissen: „Für mich war der Moment gekommen, mich meiner Verantwortung zu stellen und die Menschheit gegen die bevorstehende Invasion zu verteidigen.“
Während frühe Schachprogramme ‚nur‘ 50.000 Züge berechnen konnten, schaffte ein neues Monster 100 Millionen. Es hieß Deep Blue, lief auf einem IBM-Supercomputer und besaß ein spezielles Eröffnungsprogramm, dessen Varianten der amerikanische Großmeister Joel Benjamin zusammengestellt hatte.
1996 war es dann soweit: Deep Blue gewann eine Partie gegen Kasparov, der das Match aber für sich entscheiden konnte. 1997 gelang ihm das im Rematch nicht erneut. Deep Blue konnte mittlerweile 200.000 Stellungen pro Sekunde berechnen. Kasparov verlor das Match.
Der Kampf des Menschen mit der Maschine endete einige Jahre später recht simpel: Menschliche Super-Großmeister traten nicht mehr gegen Computer an. Es war sinnlos geworden. „Die Vorstellung, dass wir mit Computern in sogenannten intellektuellen Bereichen konkurrieren können: Sie war von Anfang an falsch“, stellte Kasparov ernüchtert fest.
Der Titanenkampf zwischen dem Schachweltmeister und einer Maschine besitzt auch heute noch eine beinahe mythologische Bedeutung. Als ARTE ihn in der Miniserie Rematch nacherzählte, geschah etwa Verblüffendes auf unserer Website: Im All-Time-Ranking belegt eine Rezension über Rematch den 3. Platz bei den Lesern. Zwei Beiträge über die Netflix-Serie „Das Damengambit“ schafften jeweils nicht einmal die Hälfte!
Doggers erzählt diese Geschichte eines Kipppunkts der digitalen Revolution so fesselnd, so als würde man einen Schachkrimi lesen. Man versteht schnell, dass Hardware und Software aneinander gekettet sind. Ohne Rechenpower hilft das beste Programm nicht. Bits, Bytes und menschliche Intelligenz müssen zusammenarbeiten. Aber genauso spannend war die Frage, wie lange es dauern würde, bis der nächste Kipppunkt für Aufsehen sorgen würde.
Sind Schachprogramm intelligent?
Natürlich stellte sich die Frage, ob „Deep Blue“ Intelligenz zugeschrieben werden konnte. Kasparov hatte eine einfache Antwort: „Deep Blue war so intelligent, wie Ihr programmierbarer Wecker intelligent ist. Nicht, dass ich mich besser gefühlt hätte, wenn ich gegen einen 10-Millionen-Dollar-Wecker verloren hätte.“
Für Doggers ist etwas anderes wichtiger: die Schachprogramme sind stärker als ihre Nutzer geworden und können von allen Schachspielern am heimischen PC genutzt werden. Egal, ob Meister oder Amateur. Damit veränderte sich sehr viel.
„Heutzutage betrachten Supergroßmeister die Zugvorschläge moderner Schachprogramme als etwas, das der ultimativen Wahrheit sehr nahekommt“, stellt Doggers fest. Die meisten Amateure denken nicht anders.
Schachprogramme, später Engines genannt, relativierten die Dominanz der Großmeister, besonders in der ersten Partiephase. „Das Hilfsmittel ist zu gut geworden und hat sich zu einem großen Gleichmacher entwickelt“, lamentierte GM Peter Heine Nielsen.
Doggers fragte daher viele Topspieler nach ihrer Gegenstrategie. Überraschung und Gedächtnis lautete die Antwort. Ersteres erfordert ein extrem breites Eröffnungsrepertoire, in der Hoffnung, dass der Gegner auf dem falschen Fuß erwischt wird. Letzteres steht auf wackeligen Füßen, weil Spieler gezwungen waren, immer längere Varianten abzuspeichern: „Sowohl auf Spitzen- als auch auf Amateurniveau ist Schach in der Eröffnungsphase zu einer Art Gedächtnisspiel geworden“, stellt Doggers fest, weiß aber auch, dass dies nur für gleichwertige Gegner gilt. Amateuren hilft eine auswendig gelernte Stockfish-Eröffnung im Mittelspiel nämlich nicht weiter. Unter Profis ist das anders. Großmeister wie Anish Giri setzen daher nicht mehr primär auf ihr Gedächtnis, sondern auf die Variabilität ihrer Vorbereitung.
Bereits Anfang des 21. Jh. waren die Programme sehr stark. 2004 hätte eine Engine Wladimir Kramnik beim WM-Match gegen Péter Léko retten können, aber Kramniks Trainer Peter Swidler hatte eine Schlüsselstellung zu kurz von der Engine prüfen lassen. 30 Sekunden mehr Bedenkzeit und das Programm hätte die Lücke im Plan gefunden. 20 Jahre später findet Stockfish 17 die Lösung in weniger als einer Sekunde! Eine der vielen Anekdoten, die Peter Doggers in seinem Buch erzählt.
Neuronale Netzwerke
In weniger als einer Sekunde: Dies war das Ergebnis einer rasanten Entwicklung der Programme, die sich in immer schneller verbesserten. Programmierer brauchten sie nicht mehr, um zu lernen. Das taten sie selber, nachdem ihnen ein neuronales Netzwerk spendiert wurde. Es ähnelte dem menschlichen Gehirn. Nur dass es schneller war.
Das von dem britischen Unternehmen DeepMind entwickelte Programm Alpha Zero brauchte 9 Stunden, um Millionen von Partien gegen sich selbst zu spielen und erreichte dabei eine Spielstärke, die (je nach Quelle) zwischen ELO 3600 und 4000 lag. Das Programm zertrümmerte 2017 Stockfish 8 und die Macher des unterlegenen Open Source-Programms konnten ihrem Star den alten Glanz nur deshalb wiedergeben, weil sie Stockfish 12 ebenfalls mit NNUE, einem neuronalen Netzwerk (Efficiently Updatable Neural Network), ausstatteten. Es verbesserte sich selbständig.
Das war keine Ausnahme. Doggers zählt eine Reihe von KI-Programmen auf, die sich in unterschiedlichen Spielwelten durchgesetzt haben, selbst dann, wenn man ihnen Regeln des Spieles verweigerte. Kein Problem: die Programme lernten auch dann, wenn sie Menschen nur beim Spielen zuschauten. Übertragen auf den Menschen bedeutet dies: Man wacht morgens auf, hat keine Ahnung vom Schach und ist abends bereits stärker als der Weltmeister. Wer wünscht sich das nicht?
Dass DeepMind inzwischen AGI (Artificial General Intelligence) ins Visier genommen hat, ist nicht überraschend. Im Gegensatz zu den aktuellen Large Language Models (LLL) wie ChatGPT oder Google Gemini muss eine AGI nicht trainiert werden, sondern trainiert sich wie Alpha Zero selber. Ziel: die AGI soll den Menschen kognitiv übertreffen. In allen Bereichen.
Für Doggers steht fest, dass sich Schach schneller als je zuvor verändert. Von Alan Turings ersten Versuchen über die erste Computer-WM bis zu Deep Blue vergingen Jahrzehnte. Die Schachprogramme mit Brute-Force-Rechenmethode hielten sich nicht lange. Bereits 2017 trat Alpha Zero an und neuronale Netzwerke übernahmen die Herrschaft.
Aber Schach-Engines waren nur Teil einer Umwälzung, die zur Integration der KI in unser tägliches Leben führten. Die Angst vor unvorhersehbaren Konsequenzen teilt Peter Doggers nicht. Die Schachwelt scheint für ihn eine Oase der Glückseligen zu sein, in der nichts Schlimmes passieren wird: In ihr „haben wir gelernt, uns an die Entwicklung der KI in unserem Bereich anzupassen, und wenn wir sie gut einsetzen, wird ihr Nutzen alle Ängste überwiegen.“
Angesichts seines Kapitels „Die dunkle Seite: Betrug beim Schachspiel“ sprechen Doggers umfangreiche Recherchen eine weniger positive Sprache. Cheating und die seitenlange Auseinandersetzung Doggers mit der Causa Carlsen vs Niemann sollen aber kein Thema dieser Rezension sein.
Im zweiten Teil der Rezension werde ich mich stattdessen mit Teil III seines Buches beschäftigen. Dort geht es um zwei weitere Aspekte der digitalen Revolution: Online-Schach und Streaming. Beides hat die Schachkultur in nur zwei Jahrzehnten radikal verändert.