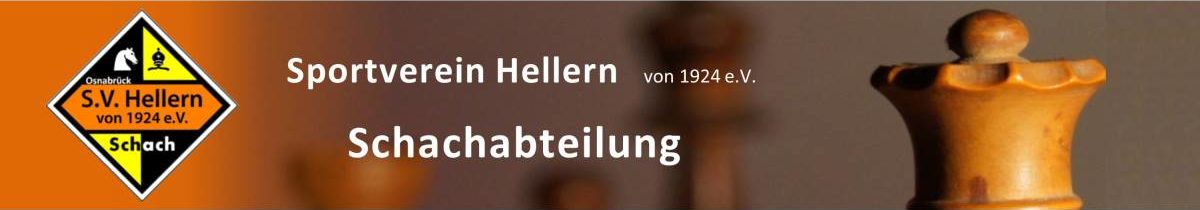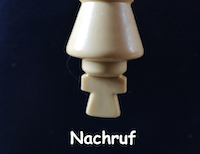Am 5. Januar 2025 verließ einer der besten Schachspieler der Nachkriegszeit endgültig seine 64 Felder. Robert Hübners Tod hinterlässt eine große Lücke. Zuletzt war er nicht mehr sonderlich aktiv, aber seine akribischen Partieanalysen werden überdauern. Und auch sein letztes Buch. Es hieß „Schund“ und war neben einigen kurzen zeitkritischen Reflexionen eine Hommage an das Amateurschach.
Verlust der guten alten Zeiten
Der 19848 geborene Großmeister triggert den Leser bereits mit dem Buchtitel. Da liegt ein Buch vor dem Rezensenten, das schlicht eingebunden ist: ein kräftiges Dunkelblau mit weißen Lettern. „Schund“ steht auf dem Einband des Buches, das auf fast 200 Seiten neben einigen Anmerkungen und Aufsätzen zum Zeitgeschehen nur Amateurpartien bereithält. Wer mag da nicht sofort daran denken, dass hier Schundpartien mit der bekannt ausufernden, aber luziden Analysekraft des Großmeisters Dr. Robert Hübner „vorgeführt“ werden sollen? Doch weit gefehlt.
„Schund“ ist ein Kürzel. Eigentlich müsste der Titel so aussehen: S.C.H.U.N.D., denn Schund bedeutet „Schachverband unverzagter Dilettanten“. Gegründet wurde der Verband von zwei begeisterten Amateuren, die abseits vom Vereinsschach Schach spielen wollten. Der Begriff „Dilettant“ stimmt nachdenklich, aber er ist nicht negativ oder boshaft gemeint. Hübner weist darauf hin, dass das italienische dilettare so viel wie „ergötzen“ heißt. Die Synonyme lauten „beglücken“, aber auch „belustigen“. So weit, so gut. Bleibt trotzdem die Frage „Warum dieses Buch?“
Offenbar hatte der deutsche Großmeister Gefallen an einem Projekt gefunden, das Schach so zelebrierte, wie er es sich immer gewünscht hatte. Eine Antwort findet man in der Einleitung. Robert Hübner redet nicht um den heißen Brei herum. Ihn schmerzt der Verlust der guten alten Zeiten, welche „der individuellen Gestaltung der Verhältnisse mehr Raum“ gaben. Hinter dieser etwas kryptischen Umschreibung verbirgt sich die Sehnsucht nach den Zeiten, in denen es keine Professionalisierung des Schachs gab. Ein paar Mannschaftskämpfe, ab und an Landesmeisterschaften. Offene Turniere für jedermann waren dagegen noch Terra Nova. Schach war vielmehr „geselliger Zeitvertreib“ wie im „Schachverband unverzagter Dilettanten“.
Das muss lange zurückliegen Aber für Hübner hält den nostalgischen Rückblick für berechtigt, und zwar, weil sich Schach im Laufe der Zeit aus seiner Sicht negativ entwickelt hat. In seiner Rückschau kommt für Robert Hübner einiges zusammen, was er missbilligt. Zum Beispiel die Einführung der ELO-Zahl in den 1960er-Jahren. Sie kann die Leistung bedeutender Schachpersönlichkeiten nicht erfassen, wie Hübner beklagt.
Und dann die Zunahme von offenen Turnieren! Sie machten aus dem Schach ein Geschäftsmodell. Hübners Kritik ist hier besonders scharf. Für ihn ist es klar, dass F. Campomanes sich 1982 die Wahl zum FIDE-Präsidenten erkaufte – „persönliche Gewinnsucht, politische Machenschaften und Willkür“, so der Autor, zogen damit in die Schachwelt ein.
Und schließlich kamen die „schachspielenden Maschinen“. Sie verbesserten zwar die allgemeine Spielstärke, dem Dilettanten raubten sie aber „die Freude an dem Erringen von Erkenntnissen aus eigener Kraft“. Nunmehr traue man nur noch der maschinellen Produktion von Zügen, so der Autor.
Und last but not least sei das Schachspiel im „Internationalen Netz“ (Hübners euphemistische Bezeichnung des Internets) gelandet, was lediglich die Quantität, aber nicht die Qualität gesteigert habe. Vielmehr erhielt das Spiel für Hübner dadurch ein Element des „Rauschhaften“.
Ja, Hübner spricht tatsächlich von einem Rausch und nicht von Euphorie und Enthusiasmus. Da beschleicht einen schon beim Lesen das Gefühl, dass der Großmeister nichts von den Lichess-Aktivisten wissen wollte, die aus seiner Sicht tagtäglich das geliebte Schachspiel millionenfach schänden. Begriffe wie Computer, Internet und Online-Schach kommen für den deutschen Großmeister also nicht in Frage. Mitunter meint man bei diesen kulturkritischen Bemerkungen die Hitze des Fegefeuers spüren zu können.
Auf den ersten Blick wirkt Hübners Kritik skurril. Seine Kritik an den Schach-Open ignorierte sowohl den Spaß am Spiel als auch den Trainingseffekt. Aber völlig daneben lag Hübner nicht. Tatsächlich ist das Internet-Schach mit seinen umfangreichen Turnierangeboten durchaus ein Konkurrent der klassischen Schachvereine geworden. Und die Engines haben das Spiel völlig verändert. Selbst Top-Großmeister spielen lange Stockfish-Varianten, weil sie als Berufsspieler darauf angewiesen sind, das Optimum an Spielstärke zu erreichen.
Auch Schach als profesionelles Geschäftsmodell kann man wie Hübner kritisch betrachten. Besonders dann, wenn man das Haifischbecken Schachbundesliga betrachtet. Aber auch dann, wenn man als Amateurverein die von einem zahlungswilligen Mäzen auf Erfolgskurs getrimmten Mannschaften ertragen muss, die durch die Verbands- und Landesligen pflügen und auch die Oberliga nur als Durchlauferhitzer betrachten. Den Berufsspielern seien diese Einnahmen gegönnt – vom Schach der Profis können aber nur wenige ihrer Opfer passabel lernen.

Hübner schreibt seine einleitenden Anmerkungen allerdings mit feinem Sarkasmus. Aber man fragt sich, ob Hübner wusste, dass Schach schon immer Geschäftsmodelle im Schlepptau hatte, etwa bei den in Schachcafés um Geld spielenden Altmeistern des 18. und 19. Jahrhunderts. Auf jeden Fall wird deutlich, warum sich Hübner nur zu gerne von diesem Treiben zurückgezogen hat und lieber Amateurpartien analysierte, die – wie er freimütig und wieder sarkastisch einräumt – mitunter seinen Verständnishorizont überstiegen.
Hohelied auf den wahrhaftigen Amateur – und dann doch exzellente Schachdidaktik!
Der Partieteil des Buches ist vom Feinsten. Hübner seziert mit übergroßer Höflichkeit und messerscharfer Genauigkeit die Partien seiner Dilettanten, die nach meiner Einschätzung auf einem Level zwischen ELO 1800 und 2000 agieren. Und dies macht den großen Wert dieses Buches aus, das sich einem Spielstärkesegment zuwendet, das in der Schachdidaktik etwas vernachlässigt wird.
Lehrbücher von Großmeistern zeigen das Dilemma. Die Autoren wollen den Lerneffekt von GM-Partien auf den Horizont von Amateuren übertragen. Das klappt erfahrungsgemäß nur selten, denn irgendwann erreicht jeder Spieler eine unsichtbare Barriere, die er nicht mehr überwinden kann. Tatsächlich gibt es (auch altersbedingt) nur wenige Spieler, die durch hartes Training ihre Rating um 200 Punkte oder mehr steigern konnten, nachdem sie zuvor jahrelang auf einem niedrigeren Level gespielt haben.
Um so interessanter ist Hübners Versuch, die Erzeugnisse des „Schachverbands unverzagter Dilettanten“ auf den Prüfstand zu stellen. Ich kenne kein Buch, das sich so konsequent bei der Wahl des Quellenmaterials auf Partien beschränkt, die ausschließlich von Nichtprofis gespielt wurden. Das ist ein Novum. Aber will der Großmeister Robert Hübner damit die Kreativität der S.C.H.U.N.D.-Amateure feiern oder läuft dann doch alles auf Schachdidaktik hinaus?
Es ist dann doch wohl Schachdidaktik. Der Erziehung zum besseren Spiel kann sich Hübner eben nicht entziehen. Vielleicht hatte Robert Hübner auch im Sinn, ein Gespür für die kreativen Freuden des Amateurschachs zu vermitteln. Aber dazu wären Hübners wie üblich ellenlangen Analysen nicht nötig gewesen. Denn dass er Wissen vermitteln will, konnte er dank dieser enormen Gründlichkeit nicht leugnen.
„Schund“ ist so gelesen nichts anderes als pure Schachdidaktik auf Top-Niveau – maßgeschneidert für ambitionierte Amateure. Und so gehört der S.C.H.U.N.D., den der Großmeister gewissenhaft einer Prüfung unterzieht, mit zum Lehrreichsten und Originellsten, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. Amateure mit einer Spielstärke um die 1800 (+- 100), aber auch stärkere Spieler, können von dem Buch garantiert profitieren.
Summa summarum vermittelt „Schund“ dem motivierten Amateur eine wahre Fundgrube großartiger Einfälle und typischer Fehler. Das Buch zeigt zudem, dass auch die ambitionierte Dilettanten zu großartigen Manövern imstande sind. So ist „Schund“ ein Hohelied auf die wahren Amateure, aber auch ein bemerkenswertes Lehrbuch. Für Anfänger ist es nicht geeignet. Dafür sind die Partien von Hübners unverzagten Dilettanten einfach zu gut.
Postskriptum: Robert Hübner haben einige Helleraner in Wijk aan Zee kennengelernt. Er saß wie alle anderen im „De Moriaan“ an der Theke oder spielte Skat mit uns. Ein ganz normaler Schachspieler mit feinem Humor. R.I.P.